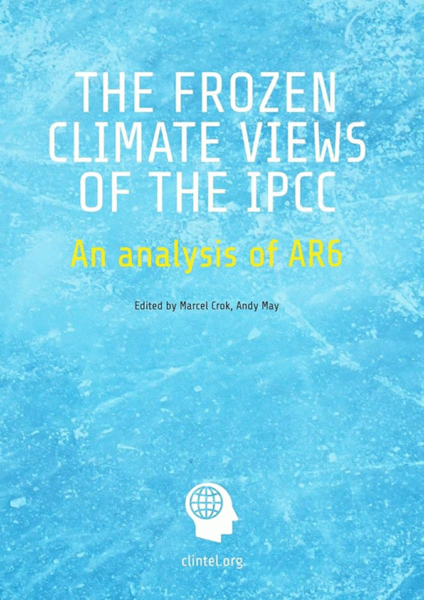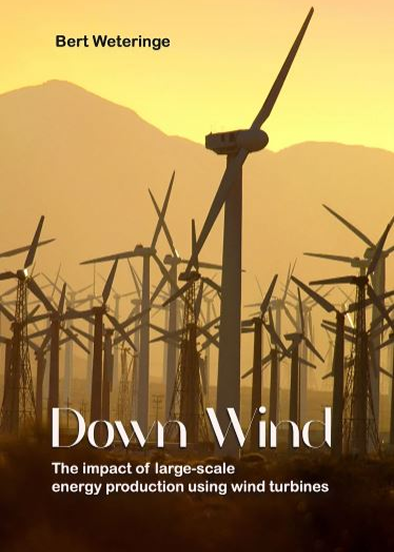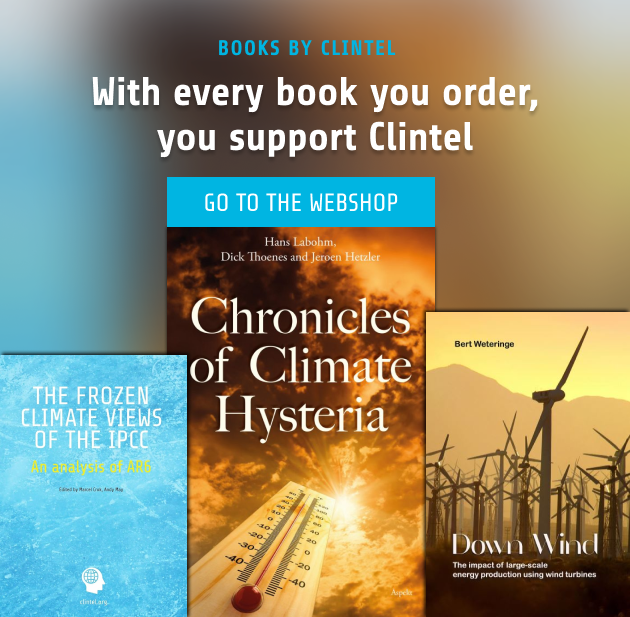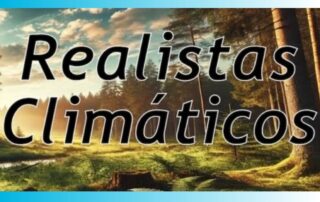Dreißig Jahre des Scheiterns der COPs: die vernichtende Bewertung eines wirklichkeitsfernen Klimaprozesses
Science-Climate-Energy bat Samuel Furfari, die These seines neuesten Buches „The Truth About the COPs, 30 years of illusions” (Die Wahrheit über die COPs, 30 Jahre Illusionen) vorzustellen, eine rigorose und dokumentierte Analyse der aufeinanderfolgenden Misserfolge dieses Prozesses, die dessen Fortführung in Frage stellt. (Dieses Buch ist Professor Ernest Mund gewidmet, der regelmäßig Beiträge für Science-Climate-Energy verfasste, mehr dazu hier).
Angesichts der COP30 in Belém in Brasilien vom 10. bis 21. November 2025, zu der fast 70.000 Teilnehmer erwartet werden, wird es wichtiger denn je, die tatsächliche Wirksamkeit dieser Klimakonferenzen kritisch zu bewerten. Diese neue Ausgabe verkörpert durch ihren organisatorischen Aufwand die wachsende Kluft zwischen dem diplomatischen Prozess und der globalen Energie-Realität. Die Ergebnisse von drei Jahrzehnten Klimaverhandlungen sind eindeutig: Trotz zahlreicher feierlicher Erklärungen und ehrgeiziger Verpflichtungen sind die globalen CO₂-Emissionen seit dem Erdgipfel, der den Dekarbonisierungsprozess einleitete, um 65 % gestiegen.
Das Scheitern: das Kyoto-Protokoll und dessen Illusionen
COP ist die Abkürzung für „Conference of the Parties” (Konferenz der Vertragsparteien), das jährliche Treffen der Staaten, die das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (Rio, 1992) ratifiziert haben, um sich zur Reduzierung ihrer CO₂-Emissionen zu verpflichten. Die erste Konferenz fand 1995 in Berlin unter dem Vorsitz von Angela Merkel statt, der damaligen Umweltministerin in der Regierung von Helmut Kohl. 1994 übernahm ich die Verantwortung für das Thema Klima in der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission, wodurch ich diese jährlichen Konferenzen bereits vor der ersten COP verfolgen konnte. Auch nach meinem Ausscheiden aus dieser Position verfolgte ich diese Konferenzen aus persönlichem Interesse weiter, wodurch ich auch ohne direkte Beteiligung einen tiefen Einblick in den Prozess gewinnen konnte.
Das Kyoto-Protokoll (1997) sollte den Beginn eines verbindlichen globalen Klima-Managements markieren. Mit dem Ziel, die Emissionen der Industrieländer bis 2010-2012 um 5,2 % zu reduzieren, läutete es das Zeitalter der quantifizierten Verpflichtungen ein. Die Realität zerstörte jedoch schnell alle Hoffnungen: Die Clinton-Gore-Regierung der Vereinigten Staaten, damals der größte Emittent weltweit, weigerte sich, das Abkommen zu ratifizieren, obwohl sie daran mitverhandelt hatte, während Kanada 2011 aus dem Abkommen austrat. Noch wichtiger war, dass die Flexibilitätsmechanismen eher eine virtuelle Übertragung von Emissionen als eine tatsächliche Reduzierung ermöglichten. Zwischen 1990 und 2010 stiegen die globalen Emissionen um 32 %, was die strukturellen Ineffizienzen eines Systems deutlich machte, das Schwellenländer von allen Beschränkungen ausnimmt.
Die Betonung, dass dieses Ziel in den Jahren „2010–2012” erreicht werden müsse – eine Forderung der Ökologen –, ist kein Detail: Diese Frist sollte den Diskurs der permanenten Dringlichkeit befeuern. Die Ziele wurden 2012 nicht erreicht, geschweige denn 2010; aber dieser Prozess sorgt auch dafür, dass die öffentliche Debatte ständig unter Druck steht.
Es sei darauf hingewiesen, dass an der COP3 keine Staats- und Regierungschefs, sondern nur Umweltminister teilnahmen, weshalb es leicht war, sich auf utopische Ziele zu einigen.
Das Kopenhagen-Debakel: Die Spaltung zwischen Nord und Süd offenbaren
Die COP15 in Kopenhagen im Dezember 2009 sollte einen entscheidenden Wendepunkt in der internationalen Klimapolitik markieren, indem sie einen Nachfolgevertrag zum Kyoto-Protokoll schuf, das als stillschweigender Misserfolg galt. Obwohl diese Konferenz lang erwartet worden war, endete sie mit einem grandiosen Scheitern, da keine rechtlich bindende Vereinbarung erzielt werden konnte. Dieser Gipfel offenbarte eine tiefe und anhaltende Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, insbesondere hinsichtlich der Aufteilung der Klimaverantwortung.
Im Gegensatz zu Kyoto waren bei der COP15 zahlreiche Staats- und Regierungschefs anwesend, die die Verhandlungen leiteten, um zu verhindern, dass „grüne” Minister ihre Länder zu übermäßig restriktiven Verpflichtungen überredeten, die angesichts der wirtschaftlichen Interessen als unrealistisch angesehen wurden. Als die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Dekarbonisierung deutlich wurden, machten viele Staaten einen Rückzieher. Es gab keine verbindlichen oder auch nur indikativen Ziele auf globaler Ebene mehr.
Schwellenländer, insbesondere China und Indien, haben jede nennenswerte Einschränkung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung im Namen des Klimaschutzes kategorisch abgelehnt. Sie beriefen sich auf das Grundprinzip der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten“ und bekräftigten ihr Recht auf wirtschaftliche Entwicklung ohne unangemessene Einschränkungen angesichts der unverhältnismäßig hohen historischen Emissionen der Industrieländer. Diese Positionen waren ausschlaggebend für die Ablehnung eines verbindlichen Vertrags und stießen auf der internationalen Bühne auf starken Widerstand.
Die Konferenz endete in einem Klima der Verwirrung und diplomatischer Spannungen, was die Unfähigkeit der UN-Gremien verdeutlichte, divergierende nationale Interessen und die Verwaltung globaler öffentlicher Güter in Einklang zu bringen.
Das Scheitern von Kopenhagen markierte einen wichtigen Wendepunkt in der internationalen Klimapolitik und zeigte, dass der UN-Konsens die tatsächlichen strategischen Interessenkonflikte zwischen Industrie- und Entwicklungsländern nicht länger verschleiern konnte. Unter dem Druck von Aktivisten und Medien gerieten die Staats- und Regierungschefs (Barack Obama, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Xi Jinping) in die Zwickmühle. Sie wurden unter Druck gesetzt, Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die ihrer nationalen Wirtschaft geschadet hätten, aber sie gaben nicht nach und zogen es vor zu scheitern. Seitdem nehmen einige kurz an der Eröffnung der COPs teil, um „im Bilde zu sein“, und verlassen dann schnell die Debatten, um jegliche Verantwortung für das Ausbleiben konkreter Entscheidungen zu vermeiden. Sobald sie fotografiert wurden, achten sie nun darauf, nicht an den Verhandlungen teilzunehmen.

Angela Merkel
Uneinigkeit in Paris: Die Einführung der Beschwörungskraft
Das Pariser Abkommen der COP21 (2015) wurde mit großem Pomp und Zeremoniell als historischer diplomatischer Erfolg präsentiert, ist aber in Wirklichkeit ein Triumph der französischen Diplomatie. Seit Monaten bemüht sich die französische Diplomatie, möglichst viele Länder davon zu überzeugen, dieses internationale Abkommen zu akzeptieren. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um ein Protokoll wie Kyoto handelt, da es in vielen Ländern den Ratifizierungsprozess nicht durchlaufen hätte. Gerade diese Berücksichtigung des Völkerrechts zeigt die Leere dessen, was als französischer Erfolg präsentiert wird.
Laurent Fabius behauptete mit Tränen in den Augen, es sei ein historisches Ereignis gewesen… Aber schauen wir uns die Fakten zehn Jahre später an: Es ist vor allem ein monumentaler Misserfolg. Es war notwendig zu versuchen, das Präsidentenmandat von François Hollande zu retten, aber es ist klar, dass diese COP den Trend nicht umkehren konnte. Hollande hatte nicht einmal den Mut, erneut zu kandidieren. Das Pariser Abkommen hat weder ihm noch den anderen geholfen – außer der EU und den Aktivisten vorzugaukeln, sie hätten den Lauf der Welt umgekehrt.
In meinem Buch habe ich das dieser COP gewidmete Kapitel auch „Die Pariser Uneinigkeit” genannt, weil es bedeutungslos ist. Es enthält nichts weiter als bürokratische Verpflichtungen, die nur den konkreten Effekt haben, unnötige Verwaltungsarbeit zu verursachen – was ironischerweise unnötigerweise zusätzliches CO₂ erzeugt. Eine schöne ökologische Farce, denn der Verbrauch fossiler Brennstoffe weltweit ist weiter gestiegen. Ihr Anteil bleibt mit fast 87 % des globalen Energiemix’ überwältigend. Nichts in diesem Abkommen ändert wirklich etwas an den Energieentscheidungen der Staaten; fossile Brennstoffe sind nach wie vor beliebt, machen sie doch in zehn Jahren 77 % des Nachfragewachstums aus, d. h. die Kluft zwischen ihnen und den erneuerbaren Energien wird immer größer (siehe auch den Artikel „Energie hinzufügen, nicht umsteigen: Fossile Brennstoffe bleiben die Grundlage des Fortschritts“ vom 18. Juli 2025 in Science-Climate-Energy).
Paradoxerweise blieb die Kernenergie – die einzige CO₂-freie Energiequelle, die reichlich und kontrollierbar Strom liefern kann – bis zur COP 28 in den internationalen Klimaverhandlungen marginalisiert. Die Entwicklung fortschrittlicher Kerntechnologien, darunter kleine modulare Reaktoren, wäre jedoch eine glaubwürdige Lösung für das doppelte Erfordernis der wirtschaftlichen Entwicklung und der Reduzierung der CO₂-Emissionen für diejenigen, die noch daran glauben. Das Beharren darauf, diese Option aus dem globalen Energiemix auszuschließen, ist ein großer strategischer Fehler, wenn nicht sogar ein historischer.
Der geopolitische Wendepunkt: Die Revolte der Entwicklungsländer
Die geopolitische Landschaft hat sich seit der Uneinigkeit in Paris erheblich verändert und markiert einen endgültigen Bruch mit dem Paradigma der Dekarbonisierung. Die Eröffnung der COP29 im Jahr 2024 in Baku durch den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, der bekräftigte, dass „fossile Energie ein Geschenk Gottes ist“, symbolisierte diesen Kurswechsel. Diese Erklärung spiegelt eine tiefere Realität wider: Afrikanische und asiatische Länder lehnen nun offen jede Einschränkung ihrer Entwicklung im Namen der Bekämpfung des Klimawandels ab. Wie der Energiebedarf des afrikanischen Kontinents zeigt, auf dem 180 Millionen Menschen in Städten mit mehr als fünf Millionen Einwohnern leben, kann die Elektrifizierung keinesfalls auf intermittierende erneuerbare Energien gesetzt werden. Die Nachfrage nach reichlich vorhandener und billiger Energie wird zur obersten Priorität und drängt die Dekarbonisierung in den Hintergrund.
Diese Veränderung war bereits auf der COP in Glasgow zu spüren, wo der niederländische Sozialist Frans Timmermans, damals erster Vizepräsident der Europäischen Kommission, den unberechenbaren Umweltschützer Boris Johnson – obwohl dieser sich als Konservativer präsentierte – davon überzeugte, Kohle zu verbieten. Nun sind beide aus dem Rennen, und der Kohleverbrauch steigt stetig. Nach Glasgow wurden wir mit COPs in den Ölförderländern (Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten) konfrontiert, die den Schwerpunkt der Konferenz wieder auf die Sicherheit der Energieversorgung verlagerten. Schlimmer noch, in Dubai fand am Rande der COP eine Konferenz zur Wiederbelebung der Kernenergie statt: Die Klimaaktivisten mussten den Becher bis zum Grund leeren. Es sei daran erinnert, dass der belgische Premierminister Alexandre De Croo fotografiert wurde, aber das Abkommen über diese Wiederbelebung der Kernenergie nicht unterzeichnen konnte, weil seine Regierung unter der Fuchtel der Grünen stand. Wenn man sich seine Karriere ansieht, kann man sich schließlich fragen, ob dieser Ökologe wirklich aus Überzeugung oder aus simpler Heuchelei fotografiert werden wollte.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Entwicklungsländer erst nach den COP-Konferenzen in Ölförderländern begannen, sich zunächst zaghaft und dann in Baku mutiger gegen die Dekarbonisierung auszusprechen. Lange Zeit ließen sie glauben, dass sie an einer Dekarbonisierung interessiert seien, indem sie sich für neue Finanzmittel aus den OECD-Ländern einsetzten. Sie wurden dabei von Klimaaktivisten ermutigt, die einen „Technologietransfer” forderten, also die Bereitstellung von Technologien – als ob Technologie kein kommerzieller Wert wäre, der privaten Unternehmen gehört und einfach kostenlos an weniger begünstigte Länder weitergegeben werden könnte. Erst als sie erkannten, dass das Geld nicht so fließen würde, wie sie es sich erhofft hatten, und dass Technologie gekauft werden musste, wagten sie es, die Umweltschützer nicht mehr zu unterstützen.
Wie kann man übersehen, dass dieser gesamte COP-Prozess nichts anderes als ideologische Manipulation, politischer Opportunismus und Gier war?

Frans Timmermans
Die Dringlichkeit des Widerstands gegen das Klima-Dogma
Die jüngsten COPs haben gezeigt, dass die eigentliche Priorität der Bevölkerung in Entwicklungsländern – insbesondere in China und Indien – nicht die Reduzierung der CO₂-Emissionen ist, sondern der effektive und schnelle Zugang zu wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung (dank des massiven Einsatzes von Kohle – der Energiequelle, die pro gelieferter Energieeinheit am meisten CO₂ produziert. Narendra Modi ist es gelungen, über eine Milliarde Inder mit Strom zu versorgen). Nur eine groß angelegte Elektrifizierung wird einen industriellen Aufschwung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und eine strukturelle Verringerung der Armut ermöglichen. Und genau das fordern die afrikanischen Staats- und Regierungschefs.
Daher muss die Energiepolitik auf Lösungen basieren, die Zuverlässigkeit, angemessene Kosten und Energiedichte bieten – Anforderungen, die derzeit nur konventionelle Energieformen, fossile und nukleare, in dem Umfang erfüllen, den diese Länder benötigen. Die Förderung der Dekarbonisierung durch die ausschließliche Konzentration auf intermittierende erneuerbare Energiequellen bedeutet, diese Länder zu einer chronischen Energieunterversorgung zu verdammen. Und das akzeptieren sie nicht mehr, so dass die COPs niemals ein Erfolg werden können.
Diese Tatsache wurde gerade von Bill Gates ausdrücklich anerkannt, der nun argumentiert, dass die Dekarbonisierung keine Priorität haben kann, da keine unmittelbar bevorstehende Klimakatastrophe wissenschaftlich nachgewiesen wurde, wie viele Wissenschaftler weiterhin behaupten, darunter auch bei Science-Climate-Energy und bei Clintel. Diese Position, die seit langem von vielen Wissenschaftlern, Ökonomen und kritischen Denkern vertreten wird, wurde von einer Presse, die sich zu sehr den Thesen der Umweltschützer verschrieben hat, systematisch marginalisiert, indem ihr eine Plattform und eine kontroverse Debatte verwehrt wurden.
Es ist klar, dass die Beseitigung der Armut einen massiven Stromverbrauch erfordert, was den Bau Hunderter konventioneller Kraftwerke mit sich bringt: Kohle-, Gas-, Wasser- und Kernkraftwerke. Diese Realität zu leugnen bedeutet, Illusionen auf Kosten des Schicksals der schwächsten Bevölkerungsgruppen aufrechtzuerhalten. Die Aktivisten haben den Kampf gegen den Klimawandel bereits verloren, bei allem Respekt gegenüber der Europäischen Kommission, welche an einer wirtschaftlich selbstmörderischen Dekarbonisierungspolitik festhält, die von den tatsächlichen Herausforderungen der Entwicklung losgelöst ist.
Es sei darauf hingewiesen, dass es weder die Äußerungen von Donald Trump noch die von Bill Gates waren, die der Utopie der COPs ein Ende gesetzt haben, sondern vielmehr die dreißig Jahre anhaltender Misserfolge, die von den Medien und der Europäischen Kommission vertuscht wurden. Sie tragen eine schwere Verantwortung.
In meinem Buch zitiere ich viele Ereignisse, welche die Unangemessenheit dieser Treffen verdeutlichen: einen Umweltminister, der wegen unüberlegter Entscheidungen von seinem Premierminister streng zurechtgewiesen wurde; die Organisation einer Konferenz in Warschau zur Förderung der Kohle während der COP; Ministerwechsel bei Treffen aufgrund ihrer Ineffizienz; oder die grotesken Diskussionen über die Größe von Kühlschränken, als der US-Botschafter bei der COP2 erklärte: „Sie werden nicht über die Größe unserer Kühlschränke entscheiden.“ Dies spiegelt direkt den berühmten Satz des Atmosphärenwissenschaftlers Richard Lindzen wider: „Wenn man den Kohlenstoff kontrolliert, kontrolliert man das Leben.“ Dies, so sagt er, sei der ultimative Traum von Bürokraten: vorzugeben, das Leben zu kontrollieren.

Bill Gates
Eine fundamentale Umgestaltung internationaler Prioritäten
Die Schlussfolgerung ist klar: Der COP-Prozess hat sein grundlegendes Ziel verfehlt, die weltweiten Emissionen zu reduzieren. Sein Fortbestehen ist nun das Ergebnis einer nutzlosen institutionellen Routine. Die beträchtlichen Summen, die für diese Konferenzen ausgegeben werden – jede COP kostet rund 100 Millionen Euro –, könnten unendlich viel besser für die Finanzierung konkreter Energie-Entwicklungsprojekte in den Ländern des Südens verwendet werden. Die Dringlichkeit liegt nicht in der Organisation neuer großer Klima-Veranstaltungen, sondern in der Anerkennung des Rechts auf Entwicklung und der Bereitstellung der für deren Verwirklichung notwendigen Energieressourcen.
Rückkehr nach Brasilien nach Rio 1992
Dreißig Jahre nach der ersten COP in Berlin ist die Bilanz verheerend: Die weltweiten CO₂-Emissionen sind seit den in Rio de Janeiro eingegangenen Verpflichtungen um fast 65 % gestiegen, was das klare Scheitern eines Prozesses verdeutlicht, der von Aktivisten und Politikern angeführt wurde, die nach Popularität strebten und konkrete Maßnahmen zugunsten steriler Beschwörungsformeln opferten. Am Vorabend der COP30 in Belém, zu der rund 70.000 Teilnehmer erwartet werden, deutet alles darauf hin, dass erneut eine Chance verpasst werden wird.
Der Kontrast ist auffällig: Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der die COP30 eröffnet hat, hat gerade die Ölförderung im brasilianischen Teil des „Äquatorialrandes” genehmigt, diesem neuen Eldorado, das sich von Guyana über Surinam und Französisch-Guayana bis zum Nordosten Brasiliens in der Nähe des Amazonas erstreckt. Dieses riesige Becken, das derzeit in voller Entwicklung ist, verkörpert den brutalen Konflikt zwischen wirtschaftlichen Zwängen und internationaler Klima-Rhetorik.
Wenn Brasilien Stefan Zweigs Versprechen einlösen will, „das Land der Zukunft zu sein und die Welt zu ernähren”, muss es sich zwangsläufig auf eine reichliche Energieproduktion stützen – und damit auf einen erhöhten Verbrauch fossiler Brennstoffe. Diese Ausrichtung steht in völligem Widerspruch zu den erklärten Zielen der COP, die das Land organisiert. Leider führt der COP-Prozess, wie dieses Buch zeigt, allzu oft zu wiederkehrender Heuchelei.
Darüber hinaus tragen Journalisten eine große Verantwortung: Sie haben ihre kritische Aufgabe verfehlt, indem sie die immense Farce dieser Konferenzen nicht angeprangert haben und somit dazu beitragen, die Illusion der Dekarbonisierung aufrechtzuerhalten, während die zugrunde liegende Dynamik unverändert bleibt.
Es ist an der Zeit, mit den Illusionen zum Klimawandel Schluss zu machen und anzuerkennen, dass die globale Priorität auf der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Zugang zu Energie für alle liegen muss. Wie die sich wandelnden Positionen der Schwellenländer zeigen, gehört die Zukunft nicht der ideologischen Dekarbonisierung, sondern dem Energie-Pragmatismus, der allein die legitimen Bestrebungen der Menschen nach Wohlstand, Lebensqualität und Wohlergehen erfüllen kann. Es ist an der Zeit, einen Prozess der Vereinten Nationen aufzugeben, der sich als ineffektiv erwiesen hat, und die internationalen Bemühungen auf die wirklichen Prioritäten zu verlagern: die Bekämpfung der Armut und die wirtschaftliche Entwicklung für alle durch den Zugang zu reichlich vorhandener und billiger Energie.
Sollen wir warten, bis die COP99 scheitert?
Dies ist eine Übersetzung des Artikels „Trente ans d’échecs des COP : le bilan accablant d’un processus climatique déconnecté des réalités“ (Dreißig Jahre Misserfolge der COP: die niederschmetternde Bilanz eines von der Realität losgelösten Klimaprozesses), veröffentlicht am 7. November 2025 in „Science, climat et énergie“.
Bildquellen: Shutterstock
Übersetzt von Christian Freuer

Samuel Furfari
Samuel Furfari ist Ingenieur und promovierter Wissenschaftler der Universität Brüssel. Er ist Professor für Energie-Geopolitik und Politik. 36 Jahre lang war er leitender Beamter in der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission. Er ist Autor zahlreicher Bücher.
more news
Climate Faithful Admit Need for Fossil Fuels
For years, critics of climate orthodoxy warned that a fossil-fuel-free future was an illusion. Now, even the world’s leading energy authorities are conceding what physics, economics, and reality have long made clear.
Spanish climate realists hold conference: “Without data, there is no crisis”
In mid-November, the first conference of the Spanish Association of Climate Realists (ARC) took place in Madrid. The event drew a full audience at Francisco Marroquín University. According to the organizers — a group of scientists from fields such as climatology, meteorology, biology, and geology — the aim was to open an alternative discussion on climate change. Their central message: fewer slogans, more evidence. “Without data, there is no crisis; without debate, there is no science.”
Time to build reactors fueled by nuclear waste
According to noted stock trader Ross Givens, many investors are pouring money into nuclear energy stocks that may never deliver. Innovative generation IV and V reactor designs remain unapproved by a slow-moving federal government. Yet investors remain hopeful that this bottleneck will soon be removed.